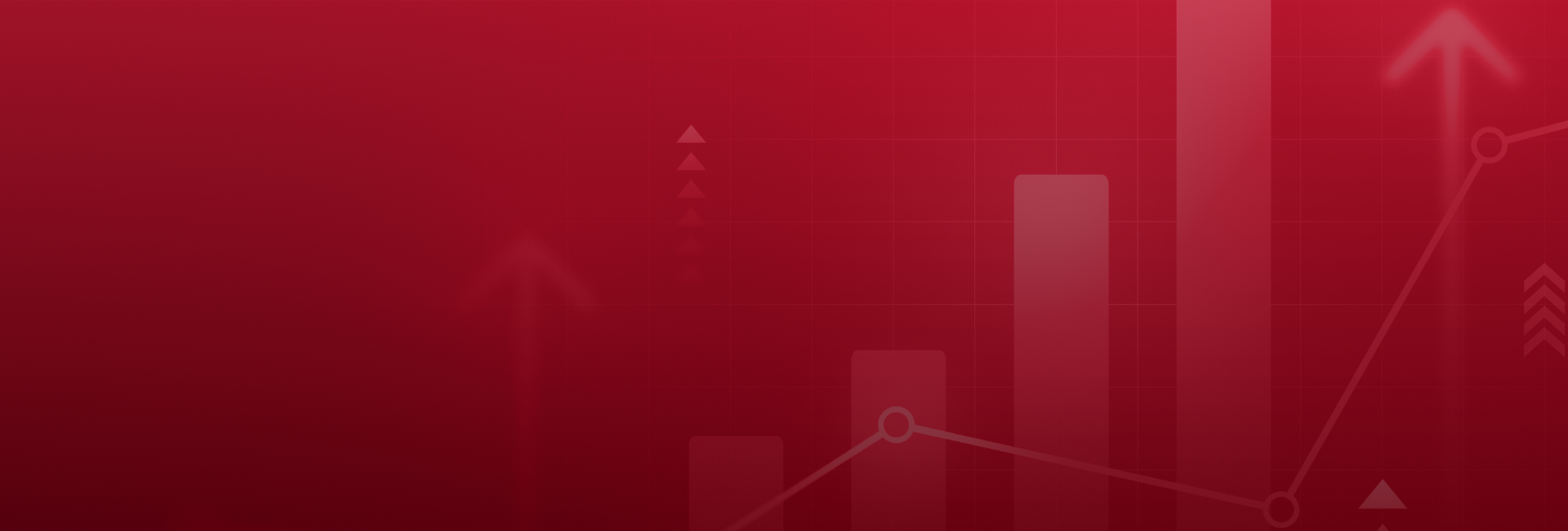Liquidität: Definition | Erklärung | Bedeutung für Unternehmen
Was ist Liquidität?
Der Begriff Liquidität bezieht sich auf die Fähigkeit eines Unternehmens, seinen finanziellen Verpflichtungen bei Fälligkeit nachzukommen. Sie ist ein Maß für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens und seine Fähigkeit, jederzeit liquide zu sein.
Wichtige Liquiditätsbegriffe für Unternehmen
Was sind liquide Mittel?
Liquide Mittel sind Vermögenswerte eines Unternehmens, die schnell und ohne wesentlichen Wertverlust in Bargeld umgewandelt werden. Durch diesen sofortigen Zugang von Bargeld sind diese Mittel maßgeblich relevant für die Liquidität, da mit ihnen laufende Verpflichtungen und Ausgaben gedeckt werden können. Zu den liquiden Mitteln zählen insbesondere:
- der Kassenbestand
- das Bundesbankguthaben
- das kurzfristig abrufbare Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
- sonstige Wertpapiere (sofern es sich um zeitnah handelbare Aktien oder Ähnliches handelt)
Cashflow vs. Liquidität
Der Cashflow eines Unternehmens bezieht sich auf die Bewegung von Barmitteln in und aus einem Unternehmen, d.h. er ist ein Maß, der den Zufluss von Barmitteln (z. B. aus Verkäufen und Investitionen) und ihren Abfluss (z. B. zur Bezahlung von Rechnungen) beschreibt bzw. erklärt. Liquidität und Cashflow hängen zwar zusammen, sind aber nicht dasselbe. Ein Unternehmen kann einen guten Cashflow haben (viele Geldeingänge), aber dennoch in finanziellen Schwierigkeiten stecken, wenn es seine Liquidität (die Fähigkeit, Rechnungen und Verbindlichkeiten bei Fälligkeit zu bezahlen) nicht effizient verwaltet. Ebenso kann ein Unternehmen einen schlechten Cashflow haben (nicht genügend Zahlungseingänge), aber dennoch finanziell stabil sein, wenn es über eine gute Liquidität verfügt (genügend Barmittel zur Verfügung hat, um seinen kurzfristigen Verpflichtungen nachzukommen).
Statische vs. dynamische Liquidität
- Statische Liquidität: Diese ist stichtagsbezogen, d.h. sie konzentriert sich auf die aktuelle finanzielle Situation eines Unternehmens, indem die vorhandenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu einem bestimmten Zeitpunkt analysiert werden. Berechnet werden kann die statische Liquidität z.B. anhand der Liquiditätsgrade 1, 2 und 3.
- Dynamische Liquidität: Diese ist periodenbezogen, d.h. sie betrachtet die Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens über einen längeren Zeitraum hinweg. Sie bezieht sich auf die Fähigkeit des Unternehmens, Cashflows zu generieren, um sowohl kurz- als auch langfristige Verbindlichkeiten zu bedienen.
Kurzum: Die statische Liquidität kann als Momentaufnahme der finanziellen Lage eines Unternehmens verstanden werden, während die dynamische Liquidität ein umfassenderes Bild der langfristigen finanziellen Gesundheit bzw. Leistungsfähigkeit eines Unternehmens vermittelt.
Kurzfristige vs. langfristige Liquidität
Kurzfristige Liquidität:
- konzentriert sich auf den sofortigen, unmittelbaren Kapitalbedarf (z.B. Gehälter, Lieferantenrechnungen, kurzfristige Kredite). Es geht primär also um den täglichen Betrieb des Unternehmens.
- Der Fokus liegt auf der Beobachtung, Bewertung und Prognose des kurzfristigen, operativen Cashflows sowie statischer Liquiditätskennzahlen wie die Liquidität 1./2./3. Grades
Langfristige Liquidität:
- Betrachtet die finanzielle Stabilität eines Unternehmens über einen längeren Zeitraum. Mit anderen Worten: Mit einer ausreichend starken langfristigen Liquidität kann ein Unternehmen seine langfristigen Schulden und Verpflichtungen erfolgreich bedienen.
- Der Fokus liegt u.a. in den Bereichen langfristige Finanzplanung, Maßnahmen zur (Um-) Strukturierung der Kapitalstruktur oder Investitionen in langfristige Vermögenswerte
- Indikatoren, die hier eine Rolle spielen, sind z.B. die Eigenkapitalquote, Fremdkapitalquote oder die Gesamtkapitalrentabilität.
Absolute vs. relative Liquidität
Die absolute Liquidität ist sehr eng gefasst und fokussiert nur die sofort verfügbaren Mittel (z.B. Bargeld und schnell liquidierbare Wertpapiere) zur Deckung kurzfristiger Verbindlichkeiten. Insgesamt gibt es starke Überschneidungen mit dem Konzept der kurzfristigen Liquidität.
Bei der relativen Liquidität wird die Perspektive erweitert, indem die Liquidität im Verhältnis zu anderen Bilanzpositionen oder Kennzahlen, und im Gesamtkontext der Unternehmensfinanzen betrachtet wird. Hier gibt es starke Überschneidungen mit dem Konzept der langfristigen Liquidität.
Überliquidität vs. Unterliquidität
Hier gelangen Sie zu mehr Infos zum Thema Überliquidität vs. Unterliquidität.
Nettoliquidität / Nettoverschuldung
Hier gelangen Sie zu mehr Infos zum Thema Nettoliquidität / Nettoverschuldung.
Liquiditätsgrade & Liquidität berechnen (Liquidität 1./2./3. Grades)
Die verschiedenen Liquiditätsgrade sind wichtige Kennzahlen im Bereich des Liquiditätsmanagements. Man unterscheidet hierbei in Liquidität 1. Grades (auch Cash Ratio genannt), die Liquidität 2. Grades (auch Quick Ratio genannt) und Liquidität 3. Grades (auch Current Ratio genannt).
Hier gelangen Sie zu mehr Infos zum Thema Liquiditätsgrade.
Welche Bedeutung hat Liquidität für Unternehmen?
Liquide Mittel geben Unternehmen Freiheit, Sicherheit und Perspektiven. Die Verfügbarkeit von freien Mitteln entscheidet über Erfolgschancen, Krisenfestigkeit und Zukunftsaussichten. Dies beeinflusst, ob Sie selbstbestimmt handeln, Ihre Ziele verwirklichen und wachsen können. Kurzum: Liquide zu sein bedeutet für Unternehmer, durchatmen zu können und Luft nach oben zu haben.
Doch was, wenn die Liquiditätsplanung scheitert und Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen können? Liquiditätsengpässe können gravierende Folgen haben und führen nicht selten in einen Teufelskreis. Und auch wenn ein Liquiditätsüberschuss im Vergleich zur Zahlungsunfähigkeit eher ein Luxusproblem ist, geht er zulasten der Rentabilität.
Wissen Sie, wie liquide Ihr Unternehmen ist? Oder wie sinnvoll eine Kapitalbeschaffung aus Ihrem eigentlichen Leistungsprozess sein kann? Häufig gilt es nur den richtigen Hebel in Gang zu setzen, beispielsweise durch eine Kombination verschiedener Maßnahmen, die unternehmensspezifisch aufeinander abgestimmt werden sollten. Und plötzlich wird sie klar und deutlich: Die Erkenntnis darüber, wie hoch die Liquidität tatsächlich ist.
Nicht genug Liquidität – oder zu viel? Wann stimmt die Balance?
Unternehmen gelten als liquide, wenn sie in der Lage sind, ihre finanziellen Verpflichtungen pünktlich zu erfüllen. Da jedoch Rechnungen und Verbindlichkeiten nicht nur im Hier und Heute existieren, ist es wichtig, auch die Zahlungsfähigkeit von morgen und übermorgen im Blick zu behalten. Die Kunst besteht darin, die flüssigen Mittel bedarfsgerecht auszutarieren.
Alles im Fluss: Liquidität im Gleichgewicht
Sie sind in der Lage, heute und in Zukunft alle laufenden Kosten wie Löhne, Energieversorgung, Versicherungen, Fuhrpark, etc. zu bezahlen? Glückwunsch! Ihr Unternehmen gilt als solvent. Ihnen bleibt nach Zahlung aller Forderungen ein Gewinn? Dann wirtschaftet Ihr Unternehmen rentabel.
Mehr Ebbe als Flut: Liquidität im Ungleichgewicht
Es kommt nicht selten vor, dass Unternehmen trotz Gewinns insolvent sind. Warum? Gewinne müssen versteuert werden, aber das Geld beispielsweise aus offenen Rechnungen fließt nicht zwangsläufig zum selben Zeitpunkt. Möglicherweise fehlt auch ein Liquiditätsplan. Ein derartiger Engpass bzw. mangelnde Liquidität kann dann weitreichende Folgen haben. Verfehlte Zahlungsziele bei Lieferanten bedeuten häufig, dass ausgehandelte Rabatte gestrichen werden oder nur noch gegen Vorkasse geliefert wird. Das belastet die Liquidität zusätzlich und verschlechtert die Bonität. Verzug gilt grundsätzlich als Negativmerkmal. Daher gilt: unverzüglich gegensteuern!
Überfluss? Zu liquide ist nicht gewinnbringend
Optimal ist die Höhe der Liquidität, wenn sie ausreicht, die fälligen Verbindlichkeiten zu begleichen. Etwas Luft nach oben ist natürlich sinnvoll. Das Gegenteil ist bei zu hohen freien Mitteln der Fall, wenn eine sogenannte Überliquidität vorherrscht. Ihre Liquidität zahlt sich aus, wenn Sie in Aufträge und Zukunftsperspektiven investieren. Würden Sie bei Ihrer Bank mehr dafür bekommen, könnten Sie Ihre unternehmerischen Aktivitäten einstellen.
Zwischen Hoch und Tief: Balance finden
Mit den richtigen Finanzierungsinstrumenten kann die Liquidität in Balance gehalten werden. Leasing und Factoring z.B. sichern das Eigenkapital und ermöglichen Investitionen zum richtigen Zeitpunkt.
Dynamik statt Stillstand: Unsere Instrumente für mehr Liquidität im Unternehmen
Liquide Mittel stecken in jedem Unternehmen: Ob im Fuhrpark, in Maschinen, in der Digitalisierung oder in Geschäftsvorgängen und Vereinbarungen. Wichtig ist, sie zu erkennen und wieder flüssig werden zu lassen. Dynamisches Handeln ist gefragt, um sich auch für eine ungewisse Zukunft zu wappnen. Alternative Finanzierungsformen können neue Wege ebnen, liquide Mittel zu generieren und dienen als ein weiteres Standbein für agiles Wirtschaften. Insbesondere Factoring und Leasing bieten Lösungen für aktuelle Herausforderungen und setzen auf die innere Stärke Ihres Unternehmens unabhängig von äußeren Kapitalgebern.
Wichtig zu wissen: Gerade in schwierigeren Unternehmensphasen bekommen alternative Finanzierungen wie Leasing oder Factoring eine besondere Relevanz. Sie stellen das zu finanzierende Objekt stärker in den Vordergrund und die eigentliche Bonität des Kreditnehmers rückt ein Stück in den Hintergrund.
Mit Leasing die eigene Liquidität schonen
Dank innovativer Produktentwicklungen gibt es kaum ein Wirtschaftsgut, das sich nicht per Leasing anschaffen lässt. Dabei ist Leasing mehr als eine reine Finanzierungsalternative. Viele ergänzend angebotene Dienstleistungen wie Reparaturen, Schadensmanagement, Inspektion, Wartung und weitere Services reduzieren Ausfallzeiten und erleichtern die Nutzung der geleasten Güter über den kompletten Lebenszyklus. Das schafft Freiräume für Ihr Kerngeschäft.
Die Vorteile von Leasing:
- Schonung der Liquidität
- Kostentransparenz und -planbarkeit
- Investitionsmöglichkeiten trotz geringem Budget
- Erhaltung der Bank-Kreditlinie
- Bilanzneutral und steuerlich von Vorteil
- Einfache Vertragsgestaltung
Factoring für sofortige Liquidität
Verkaufen Sie Ihre Forderungen aus Warenlieferungen und Dienstleistungen und erhalten Sie sofortige Liquidität unmittelbar aus Ihren Außenständen. Factoring ist weit mehr als eine Form der Unternehmensfinanzierung: Neben sofortiger Umwandlung von bisher bloßen Forderungen in Liquidität bietet Factoring umfassenden Schutz vor Forderungsausfällen und beinhaltet - falls gewünscht - die Übernahme des Forderungsmanagements inklusive Mahn- und Inkassowesen. Die Liquiditätsplanung wird dadurch um ein Vielfaches einfacher.
Die Vorteile von Factoring:
|
|
Fazit
Liquidität ist nicht alles, aber ohne Liquidität ist alles nichts. Finanzielle Hürden können jeden ereilen, in der momentanen Situation sowieso. Grund genug, das Thema intensiv zu durchleuchten und Möglichkeiten auszuloten, Engpässe aufzulösen und bestenfalls zu vermeiden. Genau dabei unterstützt Sie abcfinance mit Beratung und einem breiten Produktangebot, damit Sie Ihren unternehmerischen Weg gehen können.