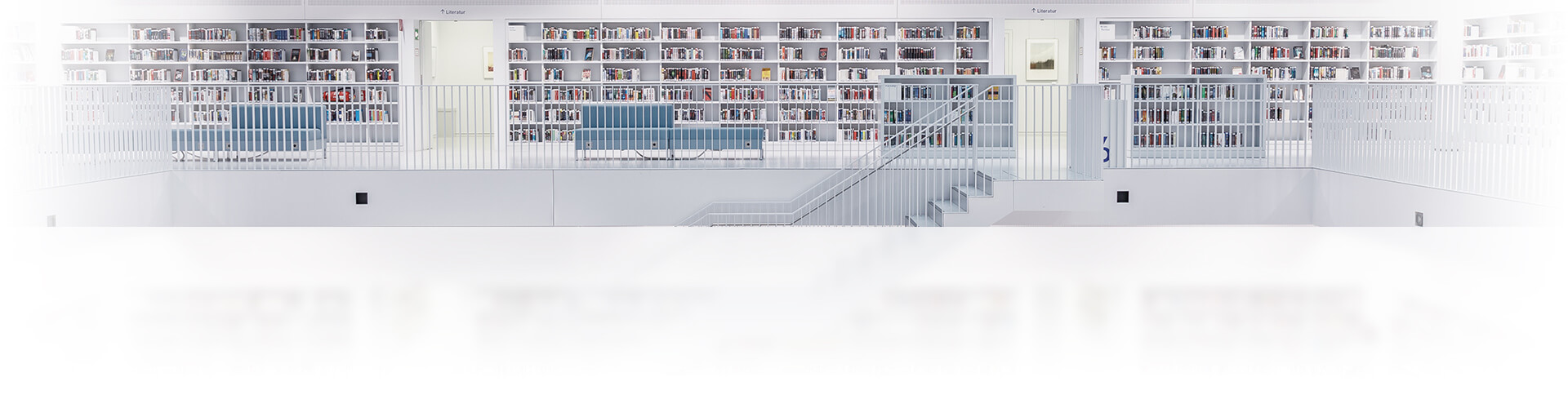
Was ist die Eigenkapitalquote?
Die Eigenkapitalquote ist in ihrer Bedeutung eine der wichtigsten Kennzahlen in der Betriebswirtschaft und beschreibt per Definition das Verhältnis des Eigenkapitals zum Gesamtkapital eines Unternehmens. Sie informiert über die Kapitalstruktur und dient als wichtige Grundlage für Finanzentscheidungen. Zudem ist die Eigenkapitalquote Indikator für die Bonität eines Unternehmens und das Risiko, mit dem es operiert.
Wie wird die Eigenkapitalquote berechnet?
Um die Eigenkapitalquote (EK-Quote) zu ermitteln, gibt es eine Formel: So werden Bilanzsumme sowie Eigenkapital des Unternehmens berechnet. Anschließend wird das Eigenkapital durch die Bilanzsumme, die dem Gesamtkapital entspricht, geteilt. Das Ergebnis wird in Prozent ausgedrückt.
Beispiel:
Das Eigenkapital eines Unternehmens beträgt 250.000 Euro. Ein Betrag von 1.000.000,00 Euro wurde als Bilanzsumme ermittelt. Aus diesen Kennzahlen ergibt sich folgende Berechnung: 250.000 ÷ 1.000.000 × 100 = 25. Der Wert 25 entspricht 25%.
Was zählt zum Eigenkapital?
Als Eigenkapital werden alle finanziellen Mittel bezeichnet, die dem Unternehmens-Eigentümer unbefristet zur Verfügung stehen und nicht zurückgezahlt werden müssen. Das Gegenteil des Eigenkapitals ist das Fremdkapital. Zusammengenommen bilden diese beiden Posten das Gesamtkapital des Unternehmens.
Um das Eigenkapital zu berechnen, werden die Bilanzpositionen miteinander verrechnet.
- Gezeichnetes Kapital
- Kapitalrücklagen
- Gewinnrücklagen
- Gewinn- bzw. Verlustvortrag und
- Jahresüberschuss/-fehlbetrag
Wie hoch sollte die Eigenkapitalquote sein?
Je nach Branchenzugehörigkeit schwankt die durchschnittliche Eigenkapitalquote. Beispielsweise haben Banken in der Regel nur eine sehr niedrige Eigenkapitalquote und bei Handelsunternehmen fällt die Kennzahl hoch aus. Unser Beispielwert entspricht den Anforderungen von Finanzexperten, die einen Richtwert von 25 % bis 30 % zugrunde legen. Liegt die Eigenkapitalquote unter 10 %, ist die Kreditwürdigkeit fragwürdig und das Risiko groß, keine weiteren Finanzierungen zu erhalten.
Was ist die Eigenkapitalrentabilität?
Die Eigenkapitalrentabilität, auch als Return on Equity (ROE) bezeichnet, ist eine weitere bedeutende Kennzahl in der Unternehmensanalyse. Sie gibt an, mit welcher Effizienz ein Unternehmen das von den Eigentümern zur Verfügung gestellte Eigenkapital einsetzt, um Gewinne zu erwirtschaften. Die Berechnung erfolgt, indem der Jahresüberschuss durch das durchschnittliche Eigenkapital dividiert und das Ergebnis mit 100 multipliziert wird, um einen Prozentwert zu erhalten. Eine hohe Eigenkapitalrentabilität signalisiert, dass das Unternehmen profitabel arbeitet und seine Ressourcen effektiv nutzt, was besonders Investoren und Finanzanalysten interessiert. Damit bietet die Eigenkapitalrentabilität wertvolle Einblicke in die Rentabilität und Attraktivität eines Unternehmens als Investition.
Eigenkapitalquote: Je höher, desto unabhängiger
Ein hohes Eigenkapital kennzeichnet die finanzielle Stabilität eines Unternehmens und bedeutet ein Plus an Unabhängigkeit. Unternehmen, die über viel Eigenkapital verfügen, weisen nur eine geringe Verschuldung oder offene Forderungen auf. Auch der Anteil an Fremdkapital am Gesamtkapital fällt geringer aus. Durch eine hohe Eigenkapitalquote verbessert sich die Bonität und Verhandlungen mit Banken und Geschäftspartnern können leichter geführt werden. Je höher der Anteil des Eigenkapitals ist, umso besser ist die Bewertung durch Rating-Agenturen, Kreditinstitute und Investoren.
Welche Möglichkeiten gibt es, die Eigenkapitalquote zu erhöhen?
Je nach Ausgangslage und Ziel gibt es verschiedene Wege, die Eigenkapitalquote zu erhöhen.
1. Kapitaleinlagen: Wer über eigene Liquidität verfügt, kann dieses Geld ins Unternehmen einbringen. In einer GmbH kann neues Kapital über die Gesellschafter erfolgen oder durch die Aufnahme weiterer neuer Gesellschafter.
2. Darlehen mit Rangrückstellung: Steht kein frisches Kapital zur Verfügung, können bereits gewährte private Darlehen genutzt werden. Um Auswirkungen auf die Eigenkapitalquote zu erzielen, müssen diese mit einem qualifizierten Rangrücktritt versehen sein. Gleiches ist auch mit Gesellschafterdarlehen möglich.
3. Gewinnrücklagen: Erwirtschaftete Überschüsse werden nicht ausgezahlt, sondern im Unternehmen belassen (Thesaurierung).
4. Beteiligungen: Unternehmen können verschiedene Beteiligungsprogramme von öffentlichen Beteiligungsgesellschaften nutzen. Dabei handelt es sich um stille Beteiligungen, die bis zu zehn Jahre laufen und dem wirtschaftlichen Eigenkapital zugerechnet werden. Die Beteiligungsgeber erhalten Kontroll-, aber keine Mitspracherechte.
5. Kommerzielle Beteiligungen: Stille Beteiligungen werden auch von kommerziellen Gesellschaften angeboten. Diese steigen jedoch erst bei höheren Beträgen als öffentliche Beteiligungsgesellschaften ein. Sie sichern sich im Gegensatz zu den Förderinstituten umfassendere Mitsprache- und Kontrollrechte.
6. Bilanzsumme reduzieren: Wer seine Bilanzsumme ohne zusätzliches Kapital reduzieren möchte, kann dieses Ziel durch eine Optimierung der Geschäftsprozesse erreichen. Das bedeutet: Aufträge nach Fertigstellung unverzüglich abrechnen, Verkürzung der Debitorenlaufzeit, qualifiziertes Mahnwesen einführen.
7. Factoring: Mithilfe von Forderungsabtretung und Forderungsverkauf kann das Ausfallrisiko von offenen Forderungen reduziert werden. Das verkürzt die Bilanz eines Unternehmens und erhöht dadurch ebenfalls die Eigenkapitalquote.
8. Leasing: Fahrzeuge und Maschinen oder Fahrzeuge zählen zu den teuren Anschaffungen. Leasing ist vielfach das Mittel der Wahl zur Finanzierung von hochpreisigen Gütern, weil sich ein steuerlicher Vorteil ergibt und die Bilanz nicht mit der Gesamtsumme belastet wird.
Fazit:
Eine vernünftige Eigenkapitalquote ist für Unternehmen eine wichtige Voraussetzung, um auch künftig, einfach an Finanzierungen zu gelangen. Je mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, umso besser ist die Bonität. Dafür lohnt es sich zu prüfen, wie sich die einzelnen Alternativen auf die Finanzstruktur auswirken.






